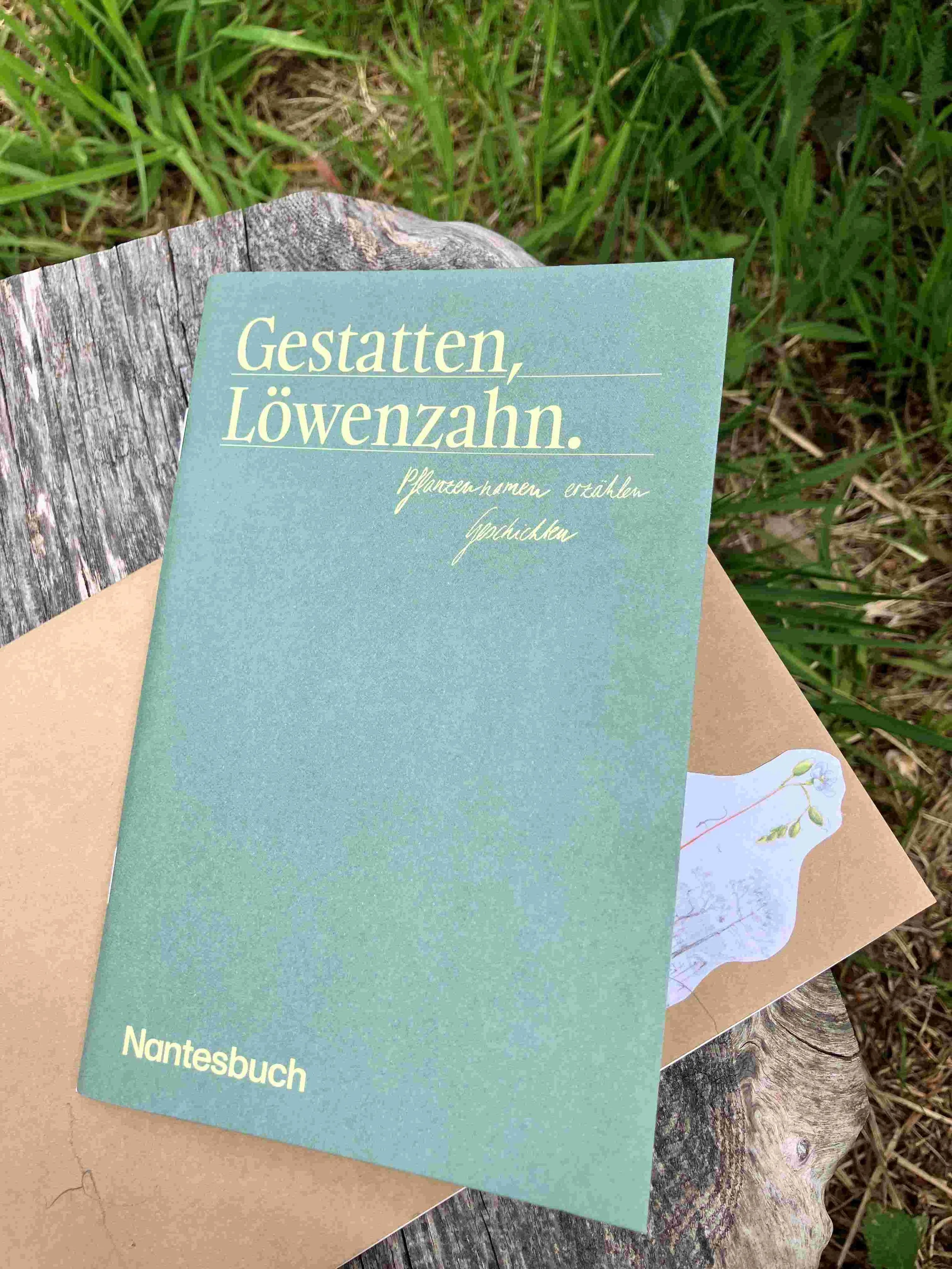Gute Orte
“Im FLUX kannst du entspannen,
ohne etwas kaufen zu müssen.
Es ist ein Ort für alle - offen, bunt und zum Mitmachen.
Die Idee hinter FLUX: Eine lebendige Gemeinschaft, Gespräche und Austausch.
Ziel ist es, Kultur fest in den Alltag einzubinden und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu schaffen
- mitten in der Stadt.”
The Great Good Place
Mit dem Begriff “Dritter Ort”, englisch “third place” oder “great good place” werden in der Soziologie Orte der Gemeinschaft bezeichnet, die einen Ausgleich zu Familie und Beruf bieten sollen, wobei die Familie der “Erste Ort” ist und die Arbeitsstelle der “Zweite Ort” ist. 1989 veröffentlichte der US-amerikanische Soziologe Ray Oldenburg das Buch “The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Community Centers, Beauty Parlors, General Stores, Bars, Hangouts, and How They Get You Through the Day”. Oldenburgs Ideal waren europäische Städte mit lebendigen Quartieren, wo sich die Menschen regelmäßig und zwanglos treffen: in England etwa im Pub, in Italien in der Lieblingsbar oder in Bayern im Biergarten.
Die Stadtsoziologin Sabine Meier von der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden definiert Dritte Orte sehr weit als Räume oder Plätze, die es vielen Besucher:innen ermöglichen, sich dort zwanglos zu begegnen und auszutauschen, auch ohne festes Programm und Konsumzwang.
1.Ein Buch
“Wir wohnen in unseren Gefühlen wie in Häusern.
Sie haben eine Architektur,
in der leben wir.”
“Es braucht einen Raum mit vielen Rissen, durch die jeweils unterschiedliches Licht in den Raum fällt.”
In Harald Welzers neuem Buch “Das Haus der Gefühle” geht es viel um “gute Orte”, innere und äußere.
Welzer geht es bei dem Bild des Hauses darum, welche individuellen Erfahrungen Menschen im Leben gemacht haben und wie diese ihre Beziehung zur Welt prägen. Von Anfang an. Er versteht dieses Haus, diesen Ort als Ausgangspunkt, von dem aus man sich aufmachen kann, die Welt zu entdecken. Oder auch nicht.
In der Architektur der Gefühle kann man sich im glücklichen Fall gut aufgehoben fühlen, beheimatet. Oder unwohl im schlechteren Fall, mit einem unklaren Gefühl, unbehaust zu sein. Fehl am Platz. Und dann fehlt auch das Zukunftsvertrauen.
Zukunft braucht Herkunft
Welzer bezieht sich auf die Bindungstheorie von John Bowlby, wonach es drei Bindungsformen gibt: Die sichere Bindung, die unsicher-vermeidende und die unsicher-ambivalente. Die Ursache liegt in der Qualität der frühkindlichen Beziehungen zwischen dem Säugling und der Bezugsperson. Hier entsteht die Basis dafür, ob die Welt später entweder als sicherer oder als unsicherer Ort betrachtet wird.
Die sichere Bindung ist also ein zentraler Raum im “Haus der Gefühle”.
Diese frühkindlichen Prägungen lassen sich später nur schwer “nachnähren”. Aber es ist möglich. Das weiß ich aus meinen eigenen Erfahrungen als Coachin.
Und gute soziale Orte, wie z.B. gute Freundschaften, tragen ebenfalls zur Verbesserung der Statik des Hauses bei.
“Deshalb braucht es ein solides Haus der Gefühle, in dem man Resonanz, Beheimatung und Freundschaft erfährt. Dieses Haus hat eine Statik, und es ist nicht weniger real als ein Haus aus Stein oder Beton. Es braucht, heute mehr denn je, eine stabile Architektur der Gefühle.”
Woher weiß man, was ein guter Ort ist?
Manchmal spürt oder sieht man es sofort. Auch was ein schlechter Ort ist, teilt sich oft unmittelbar mit.
Welzers vergisst auch nicht das Parade-Beispiel, die Helsinki Central Library Oodi. Ein Ort, der weit über das hinausgeht, was man traditionell unter einer Bibliothek versteht. Es ist ein kultureller Lebensraum, ein “Wohnzimmer der Gesellschaft”. Im Erdgeschoss befinden sich ein Restaurant, ein Kino, sowie Räume für Meetings und für Jugendliche. Im Zwischengeschoss stehen Arbeitsplätze, Studios für Tonaufnahmen, Räume zum Musizieren, Nähstudio und Werkstatt, Geräte zum Digitalisieren verschiedener Medien oder 3D-Drucker zur Verfügung. Bücher und andere Medien gibt es auf der dritten Etage, dazu „Lese-Oasen“, ein Café und einen Kinderspielplatz. Werktags ist das Oodi von 8 - 21 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 10 - 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.
“Wenn in einer Gesellschaft Gefühle von Beheimatung, Zugehörigkeit, Willkommensein gegeben sein sollen, ist es unabdingbar, dass es offene Orte gibt, an denen sich Menschen anlasslos treffen und aufhalten können.”
Ich finde es inspirirend, darüber nachzudenken, welche Faktoren gute Orte ausmachen.
2.Ein Glück, ein Geschenk
“nicht zu unterschätzen: der giersch
mit dem begehren schon im namen - darum
die blüten, die so schwebend weiß sind, keusch
wie ein tyrannentraum.
kehrt stets zurück wie eine alte schuld,
schickt seine kassiber
durchs dunkel unterm rasen, unterm feld,
bis irgendwo erneut ein weißes wider-
standsnest emporschießt, hinter der garage,
beim knirschenden kies, der kirsche: giersch
als schäumen, als gischt, der ohne ein geräusch
geschieht, bis hoch zum giebel kriecht, bis giersch
schier überall sprießt, im ganzen garten giersch
sich über giersch schiebt, ihn verschlingt mit nichts als giersch.”
Ein guter Ort
Im Rahmen des Weiterbildungsmasters “Kulturelle Bildung an Schulen” der Universität Marburg hatte ich das große Glück einen Tag bei der Stiftung „Kunst und Natur“ im bayrischen Nantesbuch zu hospitieren.
Im Programm war eine „Familienwanderung“ angekündigt mit dem Titel: „Pflanzen und ihre Namen“. Eine Ausschreibung, die den ganzen Zauber des Nachmittags nicht im Entferntesten einfangen konnte. Aber von Anfang an ….
Das verantwortliche „Team des Tages“ bestand aus zwei wissenschaftlichen Volontärinnen, einer Expertin für „nature journaling“ vom LBV, und dem Kurator für Natur, Sinan von Stietencron.
Darf ich dir einen Namen geben?
Was sagen Namen über Pflanzen aus? Wer hat sie ausgesucht oder erfunden? Was würden Pflanzen wohl sagen über die Namen, die wir ihnen gegeben haben? Welche anderen Namen würden wir finden?
Der Nachmittag war eine Expedition, eine Forschungsreise und die Einführung begann genau so: „Wir machen eine Zeitreise in das Jahr 1799, als Alexander von Humboldt nach Südamerika kam und der Flora dort einfach Bezeichnungen gab.“ Eine bunte Gruppe aus ca. 15 Erwachsenen und 6 Kindern machte sich auf den Weg, die Natur bei Nantesbuch zu erforschen.
Gleich zu Anfang wurden wir von der „Namensbewahrerin“ Veronika in die Welt der ersten Pflanze hineingezogen: Giersch, auch unter dem Namen „Grittchen hinner der Heck“ bekannt. Wie poetisch. Oft eher als Unkraut bekannt, hören wir ein sehr schönes Gedicht von Jan Wagner.
Unterm Hollerbusch
Beim nächsten Halt wurden wir zur Tandem-Arbeit angeregt: Jede/r suche sich eine Blume, Blüte o.ä. und gehe dann in die Erforschung und den Austausch. Da gerade Hollerblüte war, zog mich der weißgesprenkelte und verführerisch duftende Busch magisch an. Wie viele Blüten sind das wohl? Was passiert mit dem Busch, wenn ich ihm seine Blüten wegnehme und Hollerkücherl oder Sirup draus mache?
So viele Fragen, da half nur das intensive Erforschen: Riechen, Schmecken, Anfassen. Noch Wochen später werde ich magisch von jedem Hollerbusch angezogen, als hätten wir ein unsichtbares Band, eine Beziehung geknüpft. Eben miteinander kommuniziert, in Resonanz gegangen. Und so hatte ich mit meiner Tandem-Partnerin einen regen Austausch im Dreieck von ICH - DU - HOLLER.
Eine persönliche Erfahrung wird geteilt, Vertrauen entsteht
Die nächste Station machten wir am Waldrand. Einfache Holzbänke im Kreis luden zur Rast ein. Und etwas Unerwartetes geschah: Sinan teilte mit uns eine sehr persönliche Erfahrung. Wir sollten zunächst darüber nachdenken, wie zufrieden wir denn mit unserem (Vor-)Namen sind. Wollten wir ihn schon einmal ändern? Schließlich wurde er uns ja von anderen gegeben. Sinan, so erfuhren wir dann, hieß früher anders. Irgendwann war der richtige und wichtige Zeitpunkt in seinem Leben gekommen, wo er seinen Vornamen änderte.
Und ich begann zu grübeln. Wollte ich nicht früher immer so heißen wie meine Mama? Was hinderte mich jetzt im Erwachsenenalter? Er fragte uns auch danach, welche Spitznamen oder Kosenamen wir von wem als Kind bekommen hatten. “Hämekin” fiel mir ein. Das hat irgendwas mit Kleinsein zu tun. Hatte mich nicht mein Vater so genannt? Und was war das für eine Sprache? Ein Kollege nannte mich später immer “Chrischt”. Diesen Spitznamen mag ich nach wie vor sehr.
Zeit für den Rückweg. Wir wurden im langen Haus mit einem gemeinsamen Abendessen verabschiedet. Ich setzte mich zu Sinan und dem Team und alle schienen so zufrieden, wie ich mich auch fühlte.
Ein Fazit
Die Zeit verging wie im Fluge. Der Input war angenehm reduziert: Wir mussten nicht 20 oder 100 Pflanzenarten finden, betrachten, zeichnen, kennenlernen, sondern wenn es hoch kommt waren es 6. Wenn man in Schulen in diesem Tempo lernen würde, wäre das inakzeptabel. Doch wie viel nachhaltiger ist das, was ich an diesem Nachmittag erfahren, erfühlt, gerochen und geschmeckt hatte? Alle Sinne waren involviert, wir waren in Bewegung, äußerlich und innerlich. Pausen ermöglichten Philosophieren, Austausch und Kontemplation. Die eingeplante Zeit war schnell rum, doch nie kam ein Gefühl von Hetze oder Stress auf. Das Geschaffte war das, was wir schaffen wollten. Die Begleitung des Teams war sanft und unaufdringlich. Kleine Akzente luden dazu ein, sich im Hier und Jetzt die Umgebung in Langsamkeit anzuverwandeln.
“Sinnliche und sinnvolle Erfahrungen,
die einen zur Besinnung kommen lassen.”
P.S.
Einige Zeit später entdecke ich auf dem youtube-Kanal von Nantesbuch ein Video unseres Ausflugs:
3.Eine Pädagogik
“Hilf mir, es selbst zu tun.
Zeige mir, wie es geht.
Tu es nicht für mich.
Ich kann und will es alleine tun.
Habe Geduld, meine Wege zu begreifen.
Sie sind vielleicht länger,
vielleicht brauchen sie mehr Zeit,
weil ich mehrere Versuche machen will.
Mute mir Fehler und Anstrengung zu,
denn daraus kann ich lernen.”
“Vorbereitete Umgebung” bezieht sich auf Raum, Zeit und soziales Umfeld
Die “Vorbereitete Umgebung” ist ein didaktisch gestalteter Rahmen, in dem die Kinder alles vorfinden, was sie in der aktuellen Entwicklungsperiode brauchen. Das umfasst den Raum (Material, Räumlichkeiten), die Zeit (im eigenen Tempo lernen, lange Zeitspanne) und das soziale Umfeld (altersgemischte Gruppe, für diese Altersgruppe ausgebildete Pädagogen). Diese Umgebung wird von den Montessori-Pädagog:innen gestaltet zu einem respektvollen, achtsamen und ästhetischen Lebensraum. Ihre Rolle ist dabei eher eine anbietende und helfende. Montessori wählte hierfür das Bild eines Chauffeurs, der die Aufgabe hat, das Auto auf dem Weg zu halten, nicht aber es anzuschieben.
Dabei werden die unterschiedlichen Bedürfnisse in den jeweiligen Entwicklungsperioden berücksichtigt: In der Phase von 6-12 Jahren steht z.B. das eigenständige Forschen im Vordergrund.
In der Pubertät braucht es ein “anderes” Lernen
Für die Phase von 12-18 Jahren hat Montessori ein eigenes Konzept entwickelt: den “Erdkinderplan”. Ideal für diese Phase sind außerschulische Lernorte, an denen Natur und Draußensein, eigenes Tun und Erleben und die Gemeinschaft der Gleichaltrigen im Vordergrund stehen. Ein absolut genialer Einfall, dessen Umsetzung und Erfolg ich an verschiedenen Montessori-Schulen erleben konnte.
Ein beeindruckendes Beispiel ist die “Jugendschule Schlänitzsee” der Montessori-Oberschule Potsdam, an der ich 2023 hospitiert habe.
Natalie Knapp betont in ihrem Buch “Der unendliche Augenblick” die Bedeutung der Pubertät als besonders kreative Übergangszeit und hebt auch diese Schule hervor, die etwas verstanden hat, was im “normalen” Bildungssystem bis jetzt kaum Beachtung findet.
“Die staatliche Montessorischule Potsdam betreibt [...] seit vielen Jahren eine Jugendschule, in der sich Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis 16 Jahren gemeinsam mit Experten herausfordernden Projekten widmen. Ganzjährig und abwechselnd zum normalen Unterricht. Sie betreiben Landwirtschaft, bauen, kochen, betreuen Gäste oder stellen kulturelle Ereignisse auf die Beine. Sie stehen vor echten Problemen, stellen echte Fragen und finden echte Lösungen. Sie gestalten die Welt, in der sie leben, und erleben, dass sie das können.”
Knapp, Natalie (2015): Der unendliche Augenblick. Warum Zeiten der Unsicherheit so wertvoll sind. Rowohlt
Nantesbuch – Stiftung Kunst und Natur (2025): Wie klingt eine Pflanze? Rückblick auf eine besondere Familienwanderung. https://www.youtube.com/watch?v=5eoq2GHx6rI (Zugriff: 15.10.2025)
Wagner, Jan (2014): Regentonnenvariationen. München: Carl Hanser Verlag
Welzer, Harald (2025): Das Haus der Gefühle. Frankfurt/Main: S. Fischer Verlag.